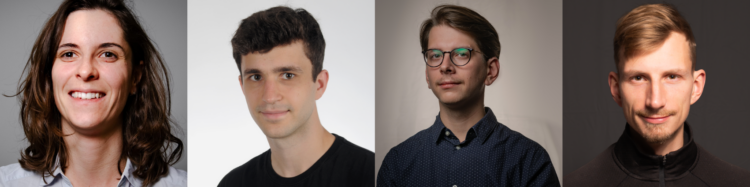
Meet The Team Part 5-8
In unserer neuen Reihe ‚Meet The Team‘ stellen sich unsere Mitarbeitenden am td vor. Heute sind es Aline, Benas, Marek und Sebastian:
Frage 1: Wie gestaltete sich dein bisheriger Werdegang?
Aline: Ich habe Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Harz in Wernigerode studiert. Für den Master in Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie und Mensch-Maschine-Interaktion (HPSTS) bin ich dann nach Dresden gekommen. Dort haben mich die Module Ingenieurpsychologie, Verkehrspsychologie und User Interface Engineering besonders interessiert. Neben meinem Studium habe ich als wissenschaftliche Hilfskraft in den Bereichen Akzeptanz von automatisierten Fahrzeugen (Lehrstuhl Verkehrspsychologie) und von Recyclingkunststoffen (Lehrstuhl Technisches Design) mitgeforscht. Das hat mein Interesse an der Forschung gestärkt. In meiner Masterarbeit im Bereich Verkehrspsychologie habe ich mich mit der Kommunikation zwischen Radfahrenden und automatisierten Fahrzeugen im Stadtverkehr beschäftigt. Da mich während meines gesamten Masterstudiums die Mensch-Maschine-Interaktion begeistert hat, habe ich mich beim Department Speculative Transformation (DST) beworben. Am Lehrstuhl für Technisches Design habe ich im März 2023 als wissenschaftliche Hilfskraft begonnen. Im August 2023 fing ich dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim DST zu arbeiten an, welches eng mit dem Technischen Design verknüpft ist.
Benas: Ich habe an der TU Dresden im Bachelor Physik und im Master Computational Modeling and Simulation studiert. Mich hat es schon immer interessiert, numerische Methoden in angewandten Forschungsgebieten in einem interdisziplinären Umfeld anzuwenden. So habe ich meine Masterarbeit in Kooperation mit dem td geschrieben. Im Anschluss haben wir uns entschieden, die erfolgreiche Zusammenarbeit zu verlängern, und ich bin seit Oktober 2024 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl.
Marek: Ich komme ursprünglich aus der Slowakei, aber ich habe Industriedesign im Maschinenbau in Brünn (Tschechien) studiert. Während des Studiums habe ich ein Erasmussemester in Salzburg sowie ein Sommerpraktikum in Hamburg bei einer Branding Agency mit Fokus auf Visualisierung und Verpackung absolviert. Ich habe kurz auch als Freelancer gearbeitet, hauptsächlich im Bereich Grafik und industrielle robotische Anwendungen. Am Lehrstuhl habe ich verschiedene Facetten ausprobiert, von industrieorientierten Projekten bis zum Prototyping für Forschungspartner und dem Support von Startups. Ich bin seit Februar 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Industriedesigner am td.
Sebastian: Wie viele andere Kolleg:innen habe ich Technisches Design in der Vertiefungsrichtung im Maschinenbau hier in Dresden studiert. Schon während des Studiums habe ich gemerkt, dass mich die theoretischen Hintergründe dazu wie Design funktioniert besonders interessierten. Am Lehrstuhl habe ich die verschiedenen Facetten beackert – angefangen bei industrie-orientierten Projekten bis zu theoretischen Modelldiskussionen – und dabei meinen thematischen Schwerpunkt in der Mensch-Technik-Interaktion immer weiter ausgebaut. Jetzt bin ich Team Lead der gleichnamigen Arbeitsgruppe und gemeinsam mit meinen Kolleg:innen erforschen wir, wie die Gestaltung von Bedieninterfaces unser Zusammenarbeiten mit hochautomatisierten Maschinen, Robotern und virtuellen Welten beeinflusst. Ich bin seit 2013 am td.
Frage 2: Was sind deine Aufgaben am td?
Aline: Mein Hauptprojekt ist im DST angesiedelt und beschäftigt sich mit der Entwicklung einer KI-gestützten Schreibhilfe für Forscher:innen. Dort unterstütze ich in den Bereichen nutzerzentrierte Anforderungsanalyse, Nutzerstudien und Experimente. Eng angelehnt an dieses Projekt ist meine Dissertation am Lehrstuhl für Ingenieurpsychologie im Bereich erklärbare KI. Beim Technischen Design biete ich Beratungen für meine Kolleg:innen im Bereich Methodik (z. B. Auswahl und Anwendung von Forschungsmethoden oder statistischen Auswertungsmethoden) an oder betreue Belegarbeiten von Studierenden. In der Vergangenheit habe ich auch beim Technischen Design bei Untersuchungen im Bereich der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mitgewirkt.
Benas: Ich beschäftige mich mit der Entwicklung von Fehlererkennung bei der Durchführung von Übungen im Rahmen von Physiotherapie. Dabei soll eine KI als Input Winkeldaten von Sensoren erhalten und erkennen, ob eine Übung richtig oder falsch durchgeführt worden ist. Insbesondere soll diese KI so gestaltet sein, dass ihre Entscheidungen nachvollziehbar sind.
Marek: Meine wissenschaftliche und angewandte Forschung konzentriert sich auf das Verständnis, die systematische Beschreibung und die Entwicklung von cyber-physischen Systemen sowie von Betriebskonzepten für komplexe und hochtechnische Anwendungen – vor allem im Bereich Industriemaschinen. In meinen ersten Jahren habe ich vor allem im Projekt Feldschwarm gearbeitet, wo wir uns gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung auf die Entwicklung eines voll funktionsfähigen Prototyps konzentrierten und dabei auch die Nutzererfahrung und Akzeptanz berücksichtigten. Daneben konzentriere ich mich auf die Unterstützung von Startups bei der Entwicklung von MVPs und ersten Prototypen sowie auf die Entwicklung verschiedener Roboterlösungen und Demonstratoren, derzeit hauptsächlich im Bereich der neuen 6G-Technologie. In der Lehre liegt mein Schwerpunkt auf dem Co-Tutoring von Freiformgeometrie-Modellierungskursen und der Leitung von studentischen Arbeiten.
Sebastian: Kein Design wirkt ohne Interaktion. Mit meiner Arbeitsgruppe habe ich mich dem Thema der Gestaltung von Bediensystemen verschrieben. Wo und wie werden Informationen dargestellt und auf welche Weise kann man diese manipulieren? Darauf gibt es häufig keine einfache Antwort, da Mensch-Maschine-Systeme sehr komplex sein können. Immerhin gibt es hier wie in keiner anderen Designdisziplin Werkzeuge, um die Wechselwirkung zwischen Gestaltung und menschlichem Verhalten zu beschreiben und zu untersuchen. Das wird für uns besonders spannend, wenn es um die Interaktion mit Robotern und anderen hoch-automatisierten Systemen geht. Der Austausch von subtilen Informationen wird hier viel wichtiger, neue Gestaltungsansätze werden benötigt.
Frage 3: Was findest du an deiner Arbeit besonders spannend?
Aline: Ich entdecke jeden Tag Neues, vor allen Dingen im technischen Bereich. Das interdisziplinäre Arbeiten ist anspruchsvoll, bietet aber gleichzeitig auch die Möglichkeit eines Perspektivwechsels. Beispielsweise lerne ich gerade programmieren und erhalte von den Kolleg:innen in der Informatik regelmäßig Einblicke in die Technik hinter unserem System. Häufig testen wir auch neue KI-Tools. Das Berufsbild ist sehr vielfältig: Einerseits gibt es viel theoretische Arbeit, z. B. im Bereich Literaturrecherche und Datenanalyse, andererseits komme ich auch mit Kolleg:innen oder Proband:innen aus unterschiedlichen Bereichen in Kontakt.
Benas: Mich interessiert es Probleme anzugehen, welche noch nie gelöst worden sind. Meines Wissens nach hat noch nie jemand aus Sensordaten eine Fehlererkennung, welche gut und genau genug für Physiotherapeut:innen ist, entwickelt. Ich finde es unglaublich spannend, etwas Neues und Sinnvolles mit gesellschaftlichem Beitrag zu erschaffen.
Marek: Was ich an meiner Arbeit besonders spannend finde ist die Vielfalt der Aufgaben, die mit dem Entwicklungsprozess und der Designforschung verbunden sind. Es ist faszinierend, wie ich an verschiedenen Projekten arbeiten und dabei unterschiedliche Fähigkeiten einsetzen kann. Besonders interessant ist zu sehen, wie Objekte aus der digitalen Welt in die reale Welt überführt werden.
Sebastian: Am spannendsten an der Professur für Technisches Design finde ich, dass wir uns hauptsächlich mit visionären Szenarien, ermöglicht durch innovative Technologien, auseinandersetzen. Die spannendsten haben so einen gravierenden Einfluss auf unsere Arbeitsabläufe, dass man sich deren Machbarkeit und Wirksamkeit kaum vorstellen kann. Wir sind mittlerweile Expert:innen darin, solche Visionen in erlebbare physische und/oder virtuelle Prototypen umzusetzen, in denen wir Welten simulieren können, in denen solche Zukunftstechnologien bereits Realität sind. Erst dadurch gelingt eine sinnvolle Bewertung und ein gesellschaftlicher Austausch dazu, was wir von Technologien erwarten und fordern. Erst damit gelangen wir zu Forschungsfragen, die tatsächlich entscheiden, ob wir das Potential der Technologie in die Anwendung transferieren können.





